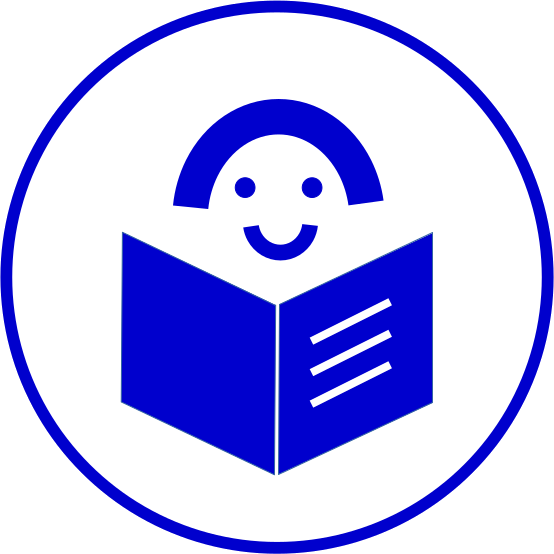Abbildung: Alois Jurkowitsch: Fernsehschrein, 1979, 60 x 50 cm, Objekt (Alois Jurkowitsch)

Kößlarn (BY)
INN Orten
4. April bis 31. Oktober 2026
Kirchenmuseum Kößlarn
Marktplatz 35
D-94149 Kößlarn
Do: 13:00 – 16:00 Uhr
Sa: 13:00 – 16:00 Uhr
So: 13:00 – 16:00 Uhr
Künstler: Alois Jurkowitsch
Kurat: Alois Jurkowitsch
Eintritt: 2 €

Geschichte
Besondere Orte
In vielen Religionen der Welt ist die Vorstellung verbreitet, dass göttliches Wirken an bestimmten Orten besonders spürbar ist. Dies gilt für den Tempelberg in Jerusalem genauso wie für die Kaaba in Mekka, Shinto-Schreine in Japan oder geheiligte Berge wie den Sri Pada (Sri Padastanaya) in Sri Lanka oder den Uluru (Ayers Rock) in Australien.
Die Idee, dass an solchen Orten eine göttliche Macht Bitten erhört und Wunder geschehen lässt, ist auch dem Christentum schon früh bekannt. Gläubige pilgerten auf teils lebenslangen Reisen nach Jerusalem (Ort von Tod und Auferstehung Christi), nach Ephesos (Ort von Tod und Himmelfahrt Marias) und zu Apostelgräbern in Rom oder Santiago de Compostella.
Andere Orte in ganz Europa wurden im Laufe der Jahrhunderte zu heiligen Orten „erhoben“, durch die Aufbewahrung von Objekten, die Kreuzzügler aus dem „Heiligen Land“ mitbrachten, durch die Gräber von Heiligen oder durch sogenannte „Hostienwunder“.
Zeichen und Wunder
In Kößlarn entstand 1364 einer der ersten Wallfahrtsorte in Bayern, der seinen Ursprung auf einen direkten Hinweis Mariens zurückführte: „Dieses Heiligtum hat sich die allerwürdigste Jungfrau erwählt“, heißt es in der ältesten (ursprünglich lateinischen) Überlieferung dazu. Und der Ort wird genau beschrieben: als steinerner Fels, der von Zweigen eines Wacholderbaums bedeckt war.
Der Wacholderbaum ist im 18. Jahrhundert eingegangen, doch der erwähnte Fels – als der von jenseitigen Mächten bezeichnete diesseitige Ort – ist an der Ostseite der Wallfahrtskirche unter einem Fresko mit der Ursprungslegende deutlich in Szene gesetzt. Auftraggeber für diese Gestaltung war Wolfgang Marius, 1514–1544 Abt von Aldersbach, der auch den zitierten Ursprungsbericht verfasste.
Der so ausgezeichnete Ort lockte in den folgenden Jahren zahlreiche Pilger aus der Umgebung an. Sie kamen, wie aus erhaltenen Aufzeichnungen hervorgeht, aus einem Umkreis von rund 40 bis 50 Kilometern – also aus dem Raum zwischen Donau und Inn und
über diesen hinaus, besonders zahlreich aber aus dem Innviertel.
Landmarken des Glaubens
Im 15. Jahrhundert entstanden vor allem links des Inns zahlreiche weitere solcher Wallfahrtszentren. Der Kult des Ortes wurde dabei (wie in Kößlarn auch) zunehmend durch den Kult um wundertätige Gnadenbilder und besondere Heilige ergänzt. Die Inszenierung des Ortes selbst blieb gleichwohl bedeutsam.
Die ehrgeizigen Turmbauprojekte in Grongörgen, Aigen am Inn, in Schildthurn oder Taubenbach zeugen davon – auch in der Barockzeit noch etwa in Brunnenthal bei Schärding oder auf dem Gartlberg bei Pfarrkirchen: die Bauwerke machten den, aus Sicht Gläubiger, von höchsten Mächten ausgezeichneten Ort weithin sichtbar.
Ludger Drost

Kunst
Bilder vom Ewigen Heimweh
Heimat. Ein Echo der Kindheit: Schlüssel und Schloss zur Flucht aus dem Gefängnis der Fremdheit, erwerbbar über Strebsamkeit und Mittun.
Dabei, nicht zu vergessen, das Schöne – die Dorfkirche, mit Blattgold beglänzte Bühne für die von Weihrauch und lateinischen Zaubersprüchen umwölkten feierlichen Rituale des katholischen Kirchenjahres. Sie erfüllten das Bewusstsein des Kindes in solchem Maß, dass für religiöse Inhalte kein Platz mehr war – es entstand auch kein Bedarf danach.
Auch als sich später ein ICH und vielfältige formale Fähigkeiten ausprägten, behauptete das Ritual seine Rolle als Erinnerung an Geborgenheit und Schönheit – zumindest eine Zeit lang. Eines hat es bis heute nicht verloren, nämlich Sockel und Hintergrund zu sein für das Lesen von mancherlei Erscheinungen.
Künstliche Ruinen in barocker Tradition, wie sie sich auch im volkstümlichen Krippenbau finden, begegnen im „Leeren Stall von Betlehem“ und im „Felsengrab – Leer“.
Die „Schlossermonstranz“, in der strengen Symmetrie gotischer Flügelaltäre, ist eine Widmung an den Vater. Er war bis zu seinem sehr frühen Tod Flugzeugmechaniker bei den amerikanischen Besatzern.
„Die Verzückung der Hl. Theresa“ ist eine fotografische Variation der ekstatischen Bildhauerarbeiten Berninis.
„Eklisiaki“ ist eine dokumentarische Fotoserie über kleine Blechkapellen auf der griechischen Insel Euböa. Auch in den entlegensten Berggegenden glimmt dort immer ein Ewiges Licht, gespeist aus Olivenöl, das in großen Colaplastikflaschen vorrätig gehalten wird.
36 Pilger- und Wanderstöcke bieten sich als Helfer an, selbst- bzw. fremdgesetzte Grenzen
zu überschreiten.
Was kommt dahinter? Das weiß ich heute besser als als Kind, auch wenn das Ewige Heimweh leise flackert: Heimat hat, wie die Freiheit, keine Grenzen und keinen Ort.
Alois Jurkowitsch


Geschichte: Besondere Orte
Auf der ganzen Welt
gibt es besondere Orte: Wallfahrts-orte.
Viele Menschen glauben:
“An diesem Ort hilft mir Gott!“
Solche Orte gibt es in vielen Religionen.
Zum Beispiel: Juden, Christen, Moslems.
Auch bei uns gibt es solche Orte!
Bei uns sind diese Orte oft
in Wallfahrts-kirchen.
So eine Wallfahrts-kirche hat oft:
einen sehr hohen Kirch-turm.
So sehen die Menschen gut:
Hier ist ein besonderer Ort!
In Bayern und Österreich
gibt es viele solche Wallfahrts-kirchen.
Diese Wallfahrts-kirchen
sind oft alt und schön.
Kunst – mit alten Dingen!
Der Ort Kößlarn ist in Nieder-bayern.
Dort gibt es ein Museum
bei einer Wallfahrts-kirche.
In dem Museum ist eine Ausstellung.
Der Künstler Alois Jurkowitsch
hat alte Dinge ge-sammelt
und Kunst daraus ge-macht.
In dieser Kunst geht es um: Glauben.